Quelle: Weiterbildungsblog
Autor: jrobes
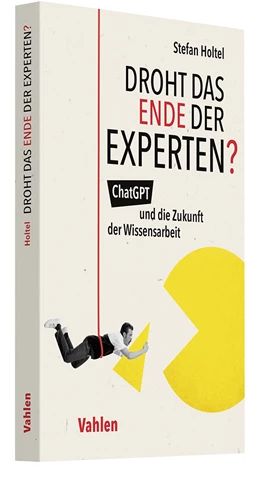 Ich bin Stefan Holtel zum ersten Mal im März 2023 auf dem Knowledge Jam der Cogneon Akademie begegnet. Dort hielt er einen interessanten Vortrag über „Die Zukunft der Wissensarbeit mit ChatGPT – von Büroklammern zu Sprachmaschinen“. Von daher war es keine Frage, dass ich mir in diesen Tagen auch sein Buch zum Thema besorgt und jetzt gelesen habe. Stefan Holtel, das noch zur Einordnung, wird im Klappentext des Buches als „Kurator für digitalen Wandel“ bei Pricewaterhouse-Coopers mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der ITK-Branche vorgestellt.
Ich bin Stefan Holtel zum ersten Mal im März 2023 auf dem Knowledge Jam der Cogneon Akademie begegnet. Dort hielt er einen interessanten Vortrag über „Die Zukunft der Wissensarbeit mit ChatGPT – von Büroklammern zu Sprachmaschinen“. Von daher war es keine Frage, dass ich mir in diesen Tagen auch sein Buch zum Thema besorgt und jetzt gelesen habe. Stefan Holtel, das noch zur Einordnung, wird im Klappentext des Buches als „Kurator für digitalen Wandel“ bei Pricewaterhouse-Coopers mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der ITK-Branche vorgestellt.
Das Buch richtet sich explizit an Wissensarbeiter, „gerade dann, wenn Sie sich nicht als Experte für ChatGPT und KI verstehen“. Man sollte auch erwähnen, dass sich Stefan Holtel in diesem Buch nur mit ChatGPT auseinandersetzt, es also stellvertretend für KI und die unüberschaubare Zahl an KI-Tools nimmt. Und er weist im Vorwort auch auf seinen Hang zu „Einführungen, Metaphern und Analogien“ hin. Zu Recht.
Doch jetzt zum Buch selbst. „Droht das Ende der Experten? ChatGPT und die Zukunft der Wissensarbeit“ umfasst 224 Seiten und ist in vier Teile und 20 Unterkapitel gegliedert. Die wichtigsten Aussagen werden vom Autor am Ende eines jeden Kapitels noch einmal kurz zusammengefasst.
Zum Inhalt des Buches
Der erste Teil des Buches, „Wie ChatGPT die Wissensarbeit durchrüttelt“, beschreibt in fünf Kapiteln, wie die KI einzelne Berufsgruppen verändert. Autoren und Journalisten, Lehrende (und Lernende), Juristen, Ärzte und Kreative. Dafür greift Stefan Holtel auf typische Prozessbeschreibungen zurück und zeigt auf, wie ChatGPT die Arbeitsschritte der genannten Professionen verändert. ChatGPT wird hier mal als „ganzheitlicher Lernbegleiter“ (für Lernende), mal als „digitale Muse“ (für Kreative) vorgestellt.
Der zweite Teil, „Die Vorgeschichte zu ChatGPT“, will vermitteln, womit wir es bei ChatGPT eigentlich zu tun haben. Dafür nutzt der Autor verschiedene Wege:
– den Blick zurück in die Technikgeschichte: wir lesen zum Beispiel vom Benz Patent Motorwagen und der Entdeckung des Penicillins;
– starke Metaphern: ChatGPT wird unter anderem als „Schweizer Messer“, „Proto-Werkzeug“ und „General Problem Solver“ vorgestellt;
– bekannte Konzepte: ChatGPT wird als „disruptive Innovation“ und im Spannungsfeld von „Automation“ und „Augmentation“ verortet.
Die zentrale Botschaft dieses Kapitels: „Der Einsatz von ChatGPT in der Wissensarbeit führt nicht schnurstracks zu einem einfachen Werkzeug, dass Antworten liefert. Dessen vornehmliche Aufgabe besteht darin, Wissensarbeitern zu helfen, bessere Fragen zu stellen. Denn richtige Antworten bleiben wertlos, solange die Frage falsch ist.“ (S. 88)
Im dritten Teil des Buches, „Stochastische Papageien. Wie spricht ChatGPT?“, mit fünf Kapiteln geht Stefan Holtel auf die Zusammenhänge von Denken, Sprache und Wirklichkeit ein und versucht, ChatGPT hier zu positionieren. Er unternimmt dafür kurze Ausflüge in die Sprachtheorie, die Geschichte der Sprechmaschinen und die Funktionsweise von ChatGPT: „ChatGPT generiert Antworten basierend auf statistischen Formeln – nicht auf der Basis menschlichen Verstehens.“ (S. 126).
Dem Prompting bzw. Prompt Engineering werden nur einige Absätze gewidmet. Das ist wohl dem Charakter einer allgemeinen Einführung in ChatGPT geschuldet. Das letzte Kapitel dieses dritten Teils beschäftigt sich mit den Grenzen von ChatGPT.
Bis hierhin ist Stefan Holtel auf Experten und die Zukunft der Wissensarbeit nur am Rande eingegangen. Diese Stichworte stehen deshalb im Mittelpunkt des vierten Teils, „Denken auf Steroid. Wissensarbeit gestalten mit ChatGPT“. Das erste Unterkapitel ist der wachsenden Bedeutung von Wissensarbeit („Wissensgesellschaft“) gewidmet. Stefan Holtel weist darauf hin, dass erste Studien zum Einsatz von ChatGPT bereits einen bedeutenden Zuwachs an Produktivität diagnostizieren. Das lange Kapitel 17, „Werkzeuge für Wissensarbeit“, kommt nach verschiedenen Ausflügen (Schreibmaschine, Technikmythen) zur Feststellung, dass wir im „Zeitalter der kreativen Generalisten“ angekommen sind: „Wissensarbeiter sollten anfangen, sich mit diesem Profil zu positionieren. Denn Generalisten entwickeln eine breite Palette von Fähigkeiten und Interessen, analysieren Probleme und finden Lösungen. Dafür nutzen sie KI-Systeme, um ihr Spezialwissen zu erweitern und sich bei Bedarf durch intelligente Maschinen assistieren zu lassen.“ (S. 169)
Diesen Gedanken führt der Autor in den letzten Kapiteln weiter aus. Auf die Frage „Welche Fähigkeiten braucht das 21. Jahrhundert?“ antwortet er: zum einen die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, und zum anderen die Fähigkeit, klare und präzise Fragen oder Anweisungen zu formulieren (siehe Prompt Engineering). Oder, wie es so schön heißt: „Schreiben wird das neue Rechnen.“ (S. 176) Wissensarbeiter werden sich zukünftig nicht mehr auf die Rollen von Kreatoren, Kommunikatoren und Koordinatoren konzentrieren können, sondern müssen zu Kombinatoren werden: „Viele Tätigkeiten, die bisher exklusiv durch Kreatoren, Kommunikatoren und Koordinatoren erledigt wurden, werden nun von Maschinen erledigt.“ (S. 184) Und: „Die prototypische Rolle zukünftiger Wissensarbeit ist der Kombinator: Er ist Generalist und Problemexperte.“ (S. 186)
Das Buch schließt mit einigen kurzen Handreichungen und Listen, mit deren Hilfe die Leser:innen selbst die eigenen Tätigkeiten und Aufgaben als Wissensarbeiter analysieren können, um dann zu prüfen, wie der Einsatz von KI bzw. ChatGPT diese Tätigkeiten und Aufgaben verändert. Schließlich: „ChatGPT ist nicht das Ende der Wissensarbeit, sondern lediglich der nächste Evolutionsschritt, in dem menschliches Denken und Entscheiden immer mehr mit Technologien verwoben wird.“ (S. 195)
Was mir aufgefallen ist
- Das Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben. Stefan Holtel versucht, mit vielen Beispielen und Geschichten, Metaphern und Analogien, in das Thema „ChatGPT“ einzuführen. Das Buch wirkt im positiven Sinne feuilletonistisch, nicht akademisch. Niemand wird durch tiefschürfende Erläuterungen zum informationstechnischen Gerüst von ChatGPT überfordert. Auf der anderen Seite wirken viele Stories, Bilder und Verbindungen etwas zufällig und anekdotisch. Und manchmal wechseln die ChatGPT-Metaphern doch arg schnell.
- Im Vordergrund stehen der individuelle Einsatz von ChatGPT, unsere persönlichen Nutzungserfahrungen sowie die einzelnen Tätigkeitsprofile von Wissensarbeitern. Die gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen wie sozialen Auswirkungen des Einsatzes von KI bzw. ChatGPT sind kein Thema. Das ist mit Blick auf den Umfang des Buches nachvollziehbar. Aber in einem (einführenden oder abschließenden) Kapitel hätte man diese Schwerpunktsetzung vielleicht noch einmal explizit ansprechen können.
- Die Auseinandersetzung mit dem Wesen der Wissensarbeit erfolgt nicht systematisch. Wir erfahren zum Beispiel, dass sich jede Wissensarbeit als eine Mischung von 3K’s (Kreator, Kommunikator, Koordinator) beschreiben lässt (S. 180). Woher stammt diese Typologie? Die entsprechende Textreferenz „469“ führt im Quellenverzeichnis zu einem Weblink mit der Domain „blog.dropbox.com“. Das ist wenig hilfreich. Überhaupt wird auf die Diskussionen um Wissensarbeit oder Wissensmanagement nicht eingegangen. Auch die Frage, wie und ob sich die Diskussionen um Future Skills und KI treffen, bildet eine Leerstelle. Kurz: In diesem Punkt wurden meine Erwartungen nicht ganz erfüllt.
- Überhaupt ist die Auszeichnung der Quellen im Buch gewöhnungsbedürftig. Auf die Nennung von Autoren und Titel wird meist verzichtet. Stattdessen oft einfache Weblinks. Das Quellenverzeichnis ist daher als Rechercheauftrag an den interessierten Leser zu verstehen.
- Ich glaube mich zu erinnern, dass uns Stefan Holtel im März im Rahmen seines Vortrags erzählte, wie er ChatGPT im Rahmen seiner Tätigkeit als Berater nutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher Abschnitt dem Buch gutgetan hätte: eine Profession aus dem ersten Teil des Buches exemplarisch zu vertiefen, sie als Wissensarbeit genauer zu analysieren und den Einsatz von ChatGPT und das Prompten für einzelne Arbeitsschritte dieser Profession durchzuspielen.
Abschließend: Wer eine Einführung in das Thema ChatGPT sucht, wer ChatGPT im Alltag nutzt, aber die Diskussionen um KI und Sprachmodelle, ihre Entwicklung und ihre Möglichkeiten, nur am Rande verfolgt, wer mehr über ChatGPT als Teil unserer Technikgeschichte erfahren will, wird das Buch von Stefan Holtel mit Gewinn lesen.
Stefan Holtel (2024): Droht das Ende der Experten? ChatGPT und die Zukunft der Wissensarbeit. Verlag Franz Vahlen: München


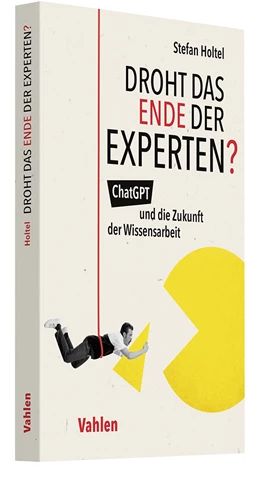 Ich bin Stefan Holtel zum ersten Mal im März 2023 auf dem
Ich bin Stefan Holtel zum ersten Mal im März 2023 auf dem