Quelle: Weiterbildungsblog
Autor: jrobes
Am 27. November werden in Berlin die besten Open Educational Resources im deutschsprachigen Raum gekürt. Vergeben werden die OER-Awards 2017. Ich bin nun Mitglied der Jury und habe in den letzten Tagen viele Einreichungen gelesen und bewertet. Denn die Zahl der Einreichungen hat sich gegenüber 2016 noch einmal mehr als verdoppelt.
Das Thema OER erlebt hierzulande gerade einen Aufwind. Offene Lehr- und Lernmaterialien stehen auf der bildungspolitischen Agenda ganz oben. Das BMBF fördert, große Bildungsinstitutionen und Stiftungen engagieren sich, aber auch viele Graswurzelprojekte haben sich OER auf ihre Fahnen geschrieben. Hier möchte ich aber schon einmal kurz stoppen und festhalten: OER ist vor allem ein Thema der Bildungs-Community und Bildungspolitik. Es geht um das Urheberrecht und Lizenzmodelle. Lernende interessiert, ob sie auf einen Kurs oder Materialien im Netz frei zugreifen können oder ob sie etwas zahlen müssen. Mehr in der Regel nicht. Deshalb richten sich OER-Projekte vor allem an Bildungsexperten und Lehrende, die selbst Lernangebote entwickeln wollen.
Wenn ich jetzt die Projektbeschreibungen der letzten Tage Revue passieren lasse, fällt noch ein anderer Punkt auf. Im Mittelpunkt vieler OER-Projekte stehen nach wie vor „Resources“, also Inhalte, Medien, Texte, Lernhilfen, Programmcodes. Auch in den Einreichungsbedingungen zum OER-Award wird vor allem nach dem Lizenzmodell, nach den „5Rs“ von David Wiley und nach der Sicherstellung der didaktischen und technischen Qualität gefragt. Es gibt auch die Frage nach der Nutzung, aber hier tun sich viele Projekte schon schwerer, Auskunft zu geben. Es gibt Zahlen über die Abrufe der Seiten, Feedback auf einzelne Funktionen und Angebote sowie Ideen zur Weiterentwicklung der Projekte. Kurz: Das Herzstück von OER, nämlich das Übernehmen und Einbetten der Lernmaterialien, bleibt oft im Dunkeln. Erfahrungsberichte von Nutzern sind selten.
Warum, so frage ich mich, werden OER-Projekte heute nicht noch stärker als Community-Projekte gedacht? Drei Punkte sind mir durch den Kopf gegangen:
- OER-Projekte sollten nicht nur als Repositories, sondern auch als Netzwerke gedacht, konzipiert, umgesetzt und gelebt werden.
- Best Practices (Fallbeispiele, Use Cases, Einsatzszenarien, …), in denen OER-Nutzer schildern, wie sie mit den Lehr- und Lernmaterialien gearbeitet haben, sollten ein wichtiger Baustein jedes einzelnen OER-Projekts sein.
- Regelmäßige Kampagnen (Themenwochen, BarCamps, Blogparaden, …), in denen sich OER-Macher und -Nutzer austauschen, signalisieren, dass ein Projekt „lebt“, und stützen die gemeinsame Arbeit und Weiterentwicklung des jeweiligen Vorahabens.
Es gibt sicher noch weitere Punkte, um OER aus der Spezialisten- und Ressourcen-Ecke herauszuholen. Das OER-Festival und der OER-Award sind Gelegenheiten, um das zu diskutieren.



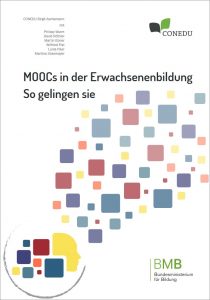 Die Macher*innen des
Die Macher*innen des